
BIOARC

EU-Projekt BIOARC
Vom Feld zum Fundament: Nachhaltig bauen mit Rohstoffen aus der Region
In der EU entfallen auf Gebäude rund 40 Prozent des Energieverbrauchs und 35 Prozent der energiebedingten Treibhausgasemissionen[1]. Um bis 2050 das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, müssen Gebäude eine bessere Gesamtenergieeffizienz aufweisen. Die Energieeffizienzrichtlinie der Europäischen Union schreibt daher eine Senkung des Primärenergieverbrauchs in Wohngebäuden um bis zu 22 Prozent bis zum Jahr 2035 vor. Biobasierte Materialien bieten ein vielversprechendes Potential für den Bau-Sektor und stehen im Einklang mit den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Allerdings weisen sie teilweise erhebliche Einschränkungen auf, u.a. eine unzureichende Feuerfestigkeit.
Ziel des EU-Projekts BIOARC ist es, regionale, ungenutzte Abfälle aus der landwirtschaftlichen Produktion wie Reisschalen (Italien), Weizenstroh (Polen), Hopfenfasern (Deutschland) und Schalen von Sonnenblumenkernen (Frankreich) in langlebige, hochwertige und feuerfeste Baumaterialien umzuwandeln, die als Dämm-, Wand-, und Akustikplatten sowie modulare Trennwände zum Einsatz kommen sollen. Diese werden in realen Demonstrationsumgebungen, darunter Pilotgebäuden, 1:1-Modellen und Gemeinschaftspavillons in vier unterschiedlichen Bioregionen[2] Europas als Prototypen getestet. Dabei sollen in jeder Bioregion lokale Gemeinschaften, Landwirtinnen und Landwirte, Designerinnen und Designer und politische Entscheidungsträger eingebunden werden, um gemeinsam Baumaterialien zu entwickeln, die kulturell relevant und auf lokaler Ebene breit akzeptiert sind. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei für alle Bioregionen die „Bioregional Weaver“ – eine lokal agierende Vermittlungsperson, die sicherstellt, dass jeder Prototyp den ästhetischen, ökologischen und wirtschaftlichen Kontext der Region berücksichtigt. Diese Aufgabe übernimmt eine Designerin und Materialforscherin, die sich durch längere Aufenthalte in jeder der Bioregionen des Projekts in diese lokalen Netzwerke einbringen wird.
Mit Bakterien zu stabilen, nachhaltigen Baumaterialien
Für die Herstellung von ökologischen Baumaterialien will BIOARC die mikrobiell induzierte Kalzitfällung (MICP - Microbially Induced Calcite Precipitation) mit einem innovativen „Green Moulding“-Verfahren (CrescoBind™) verbinden– ein neuer und skalierbarer Ansatz für die nachhaltige Produktion von Baustoffen.
Was ist die mikrobiell induzierte Kalzitfällung (MICP)?
MICP ist ein natürlicher Prozess, bei dem Bakterien Calciumcarbonat-Ausfällungen (Kalk) erzeugen. Dieser Vorgang wird benutzt, um Materialien zu verfestigen, zu stabilisieren oder nachhaltige Baustoffe herzustellen – ganz ohne Zement oder chemische Kleber.
Bestimmte Bakterien, zum Beispiel Sporosarcina pasteurii, werden in ein Material wie Sand, Erde oder pflanzliche Fasern eingebracht. Diese Bakterien sind in der Lage, in bestimmten Nährmedien Calciumcarbonat herzustellen.
Das Calciumcarbonat verbindet die Pflanzenfasern auf natürliche Weise miteinander – ganz ohne synthetische Bindemittel. Die so entstandene Masse wird anschließend in eine Form gegeben und härtet dort bei Raumtemperatur aus. Das Ergebnis ist ein festes, biologisch abbaubares und feuerfestes Material, das beispielsweise als Dämmplatte oder Wandpaneel verwendet werden kann.
Aktuelle technische Herausforderungen bei MICP
Das Standard-MICP-Verfahren funktioniert zwar grundsätzlich, steht jedoch vor mehreren technischen Herausforderungen, die eine Skalierung für die Großserienfertigung erschweren.
Problematisch ist die Verweildauer des Materials in der Form. Der Zementierungsprozess dauert in der Regel 4 bis 10 Tage, was die Produktion erheblich verlangsamt. Die Formen selbst sind ebenfalls recht komplex – sie müssen unter Druck versiegelt werden, eine gleichmäßige Verteilung der Zementierungslösung ermöglichen und mit Ein- und Auslässen für den Flüssigkeitsfluss ausgestattet sein.
Für den Prozess ist ein Druckpumpensystem erforderlich, um die Zementierungslösung durch die Formen zu drücken. Dies erhöht die technische Komplexität, den Energieverbrauch, und letztlich auch die Kosten.
Die Bindung erfolgt oft nicht gleichmäßig. Bereiche in der Nähe des Einlasses, wo die Lösung in die Form eintritt, werden oft stärker zementiert, während andere Bereiche nicht so gut binden.
Bei der Herstellung komplexerer Formen wird der Prozess noch schwieriger. Einige Bereiche werden nicht ausreichend mit der Zementierungslösung versorgt, was zu Schwachstellen bzw. gar keiner Bindung führt.
BIOARC verbindet MICP mit innovativem „Green Moulding“-Verfahren CrescoBind™
Bei diesem „Green Moulding“-Verfahren wird zunächst ein biologisch abbaubarer „Grünkörper“ hergestellt – eine vorgeformte Hülle aus Pre-Binder (z. B. Gips), zentrifugierter Bakterienpaste und Agrarreststoffen, die das Material-Substrat in leicht gebundener Form umschließt. Diese Hülle lässt sich individuell gestalten und an die regionale Architektur anpassen. Anschließend verfestigen Bakterien im Rahmen des MICP-Verfahrens den geformten Körper.
Im Gegensatz zu herkömmlichen MICP-Verfahren kommt die Kombination aus dem von der englischen Firma Cresco Biotech Ltd entwickelten CrescoBind™ und MICP ohne Pumpsysteme oder druckdichte Formen aus. Durch die feine Porenstruktur des Materials kann sich die Härtungslösung gleichmäßig verteilen. Das verkürzt die Aushärtezeit, reduziert den Energieverbrauch und senkt Kosten.
BIOARC nutzt im Rahmen des Projekts für beide Phasen regional verfügbare Agrarreststoffe. Beim “Green Moulding” (CrescoBind™) werden sie für die vorgebundene Außenhülle des Materials verwendet. Beim inneren MICP-Prozess dienen sie als Substrat und Nährstoffquelle für das Bakterienwachstum.
Bioregionale Wertschöpfung für eine klimafreundliche Bauwende
BIOARC setzt auf einen bioregionalen Ansatz und legt damit Wert auf die Verwendung lokal gewonnener Biomasse. Das stärkt die regionale Wirtschaft, schafft Einnahmequellen für Landwirtinnen und Landwirte und fördert neue Geschäftsmodelle und Arbeitsplätze. Gleichzeitig reduzieren sich Transportwege, CO₂-Emissionen und Kosten.
Durch die Integration biobasierter Materialien in nachhaltige Baukonzepte leistet BIOARC einen aktiven Beitrag zur „New European Bauhaus“-Initiative und unterstützt die Ziele des Europäischen Grünen Deals sowie eine klimafreundliche Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Damit entsteht ein Modell für regenerative Architektur in Europa und darüber hinaus.
[1] Energy Performance of Buildings Directive adopted
[2] Eine Bioregion ist ein Teil der Erdoberfläche, dessen grobe Grenzen durch natürliche und menschliche Einflüsse bestimmt sind, und der sich von anderen Gebieten durch Merkmale der Flora, Fauna, des Wassers, des Klimas, der Böden und Landformen sowie durch die menschlichen Siedlungen und Kulturen, die diese Merkmale hervorbringen, unterscheidet. (Quelle: Wikipedia)


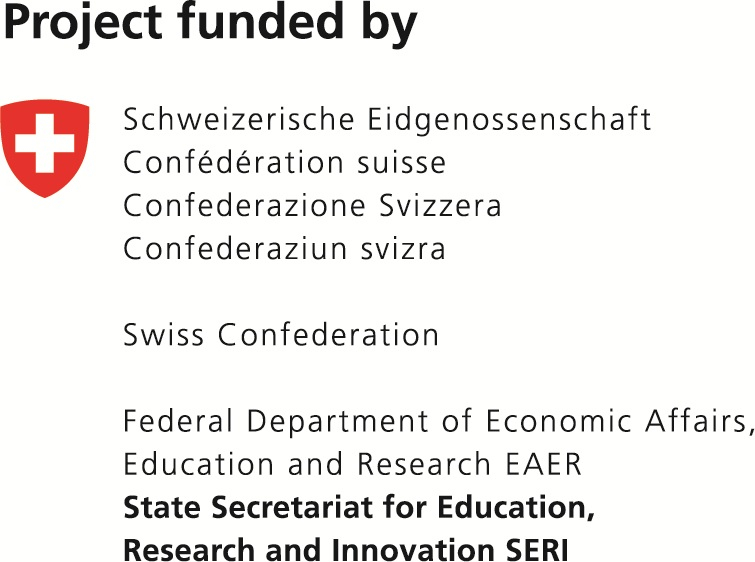
Projektziele
- Standardisierung des Biomineralisierungsprozesses MICP, sodass er für die Herstellung von Materialien aus unterschiedlichen lokalen Biomassearten zuverlässig und in größerem Maßstab funktioniert.
- Herstellung von vier verschiedenen Produkten - Dämmplatten, Wandplatten, Akustikplatten und Trennwände - unter Verwendung von vier unterschiedlichen Materialien aus lokalen Bioressourcen.
- Identifikation vielversprechender Anwendungen für biobasierte Produkte und Bewertung ihrer Skalierbarkeit und Markttauglichkeit in verschiedenen Branchen.
- Aufbau regionaler Netzwerke mit lokalen Akteuren zur Stärkung von Nachhaltigkeit, Anpassungsfähigkeit und Wissensaustausch in den Bioregionen.
- Beitrag zur regenerativen Architektur und nachhaltigen Stadtgestaltung durch biobasierte Materialien im Sinne des Neuen Europäischen Bauhauses.
Zielgruppen
- Akteure aus dem Landwirtschaftssektor
- Bauunternehmen
- Andere Unternehmen/KMU
- Forschungsinstitutionen
- Politische Entscheidungsträgerinnen und -träger
- Akteure aus der Kreislaufwirtschaft
BayFOR als Partner
In der Antragsphase unterstützte die BayFOR die Koordinatoren und das Konsortium bei der fachlich-inhaltlichen Konzeptionierung des EU-Antrags sowie bei der Klärung von finanziellen und administrativen Fragen. Die BayFOR ist Projektmanagement-Partner im BioARC-Konsortium. Zudem übernimmt die BayFOR die Koordination von Kollaborationen und Clustering-Aktivitäten. Sie bewertet Kooperationsmöglichkeiten, identifiziert Überschneidungen und initiiert gemeinsame Aktivitäten und Workshops, in denen Synergien im Hinblick auf regionale, nationale und europäische Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen werden.
Förderperiode
Dieses Projekt wird von Anfang Mai 2025 bis Ende April 2028 durch das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der Europäischen Union, Horizon Europe, mit rund 3,9 Mio. Euro unter der Finanzhilfevereinbarung Nr. 101215956 gefördert. Davon gehen 1,5 Mio. Euro an bayerische Akteure.
Konsortium
Unter der Koordination der Technischen Universität München beteiligen sich 12 Partner aus acht Ländern am Projekt:
- Technische Universität München, Deutschland
- BarthHaas, Deutschland
- Bayerische Forschungsallianz GmbH, Deutschland
- Cresco Biotech Limited, Vereinigtes Königreich
- FOODCULTURE days, Schweiz
- InnoRenew CoE, Slowenien
- INNOVATECH SRL, Italien
- InoSens, Serbien
- Terres Inovia, Frankreich
- Universität Northumbria (Newcastle), Vereinigtes Königreich
- VestaEco, Polen
- WeLOOP, Frankreich
Weitere Informationen
Webseite folgt in Kürze.
Kontakt
Projektkoordinator

Prof. Niklas Fanelsa
Technische Universität München
Professur für Architektur und Design

M.A., Dipl. Julia Ihls
Technische Universität München
Professur für Architektur und Design
E-Mail: julia.ihls@no-spam-pleasetum.de
Kontakt in der BayFOR

M. A. Verena Bürger-Michalek
Bereichsleiterin Projektmanagement
Telefon: +49 89 9901888-174
E-Mail: buerger@no-spam-pleasebayfor.org

M. A. Susanne Hirschmann
Wissenschaftliche Referentin Umwelt, Energie & Bioökonomie
Telefon: +49 89 9901888-125
E-Mail: hirschmann@no-spam-pleasebayfor.org




